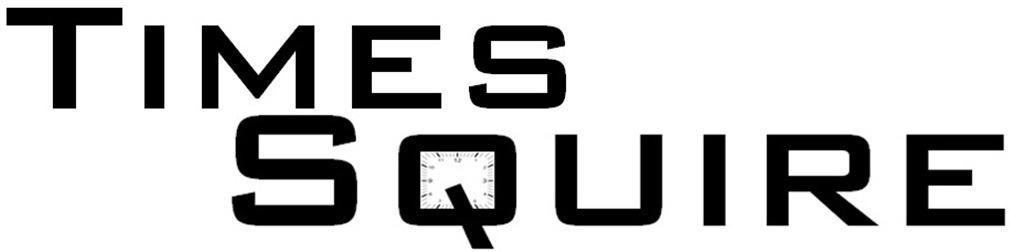Frau Klemm, Ihr Dachverband vertritt neun Millionen Versicherte in sehr günstigen und sehr teuren Kassen. Wie kommt das?
Unsere Zusatzbeitragssätze reichen von zweieinhalb bis mehr als vier Prozent. Das hängt mit der Ausgabendynamik zusammen, der jeweiligen Versichertenstruktur und mit den Rücklagen, die auf Geheiß der letzten Bundesregierungen abgeschmolzen wurden und jetzt durch höhere Zusatzbeiträge wieder aufgefüllt werden müssen. Manche kerngesunde Kasse hatte ein solides Vermögen, das nun aufgebraucht ist.
Wie sieht die Altersstruktur in der BKK-Gruppe aus?
Unsere Versicherten sind inzwischen älter als in den Allgemeinen Ortskrankenkassen. Durch unsere betriebliche Ausrichtung haben wir natürlich aber auch viele junge Leute. Die sind viel wechselfreudiger als Ältere, nutzen Vergleichsportale und reagieren sensibel auf Beitragssätze.
Einige BKK stehen nur den Angehörigen der namensgebenden Betriebe offen, der „Trägerunternehmen“. Wie viele etwa?
Es gibt noch rund zwanzig solcher geschlossenen Betriebskrankenkassen, darunter bei großen Industriebetrieben wie BMW oder Würth und auch mittelständischen Unternehmen. Etliche sind regional oder bundesweit geöffnet.
Braucht Deutschland wirklich 93 Kassen?
Zu glauben, mit weniger Kassen würde es billiger, stimmt nicht. Die Versicherten müssen ja weiter betreut werden. Der Anteil der Verwaltungskosten ist gering. Vor 25 Jahren hatten wir viermal so viele Kassen wie heute, inflationsbereinigt sind die Personalkosten seitdem sogar noch gestiegen. Fusionen kosten viel Geld, binden Personal und erzeugen Unsicherheit bei Versicherten und Beschäftigten.

Wie gut stehen die BKK im Wettbewerb?
Eine betriebsbezogene Kasse ist direkt in den Betrieb eingebunden, sie kennt die Belegschaft, die Arbeitsbedingungen und kann daher passgenauere Angebote unterbreiten. Diese Wendigkeit ist auch ohne Betriebsbezug vorhanden und unsere Stärke. Sie unterscheidet uns vom Massengeschäft. Große, behördenähnliche Kassen sind nicht automatisch effizienter oder günstiger.
Hilft diese Wendigkeit gegen Finanznot?
Auch wir merken, dass der finanzielle Druck steigt. Das Scoring des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung, der GKV, zeigt, dass für viele Kassen die Ampel tiefrot ist. Das betrifft auch die BKK. Für die betriebsbezogenen BKK ist das auch vor dem Hintergrund relevant, dass die Trägerunternehmen im Zweifel haften. Mancher Betrieb fragt sich daher nun, ob er das Risiko noch tragen will oder die Kasse lieber öffnet, weil ihm das zu heiß wird. Wir werden also weitere Fusionen sehen, aber nicht weil der Gesetzgeber das vorschreibt, sondern weil der Markt sie erzwingt.
Welche Vorteile haben Betriebskassen?
Durch die traditionell enge Bindung zu den Trägerunternehmen denken nicht nur die direkt betriebsbezogenen BKK sehr kunden- und zugleich effizienzorientiert. Das gilt auch im BKK-Dachverband: Unsere Aufsichtsratsvorsitzende kommt von MAN, der alternierende Vorsitzende von Evonik. Die Unternehmen fordern von ihren Kassen ein, dass sie wirtschaftlich und modern denken, zum Beispiel in der Digitalisierung. Trägerunternehmen und Kassen wollen, dass die Belegschaft gesund bleibt, und sie halten das Geld zusammen. Das funktioniert.
Können Sie Beispiele nennen?
Besonders stark sind wir in der betrieblichen Gesundheitsförderung, das ist unser Markenkern. Dort, wo Unternehmen Geld in Prävention stecken, haben wir nachweislich geringere Krankenstände. Das zahlt sich für beide aus, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Nehmen Sie zum Beispiel die Autokonzerne Audi oder Mercedes mit ihren Betriebsärzten. Die investieren in enger Zusammenarbeit mit ihrer BKK in die Gesunderhaltung der Belegschaft und können in ihren BKK zugleich faire Beitragssätze anbieten. Gleiches gilt für viele andere unserer Mitgliedskassen. Gute Gesundheitsbetreuung und tragbare Beiträge sind für junge Arbeitnehmer interessant. Unternehmen hilft eine gesunde Arbeitnehmerschaft im Fachkräftemangel.
Ist Prävention wirklich so wichtig?
Sie ist der Schlüssel für ein langes, gesundes Leben und zugleich für die langfristige Funktionsfähigkeit und Bezahlbarkeit der Versorgung. Derzeit sehen wir das Gesundheitswesen als Reparaturbetrieb. Es geht fast ausschließlich darum, Krankheiten zu behandeln, statt Gesundheit zu erhalten. Das zu ändern, ist eine Aufgabe für alle Lebensbereiche. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Gesundheitsstrategie und das politische Bekenntnis, das Gesundheitssystem voll auf die Gesunderhaltung auszurichten. Das Thema muss schon im Kindergarten und in den Schulen behandelt werden. Es ist nicht nur Aufgabe der Kassen, die gerade einmal knapp zwei Prozent ihrer Ausgaben in die Prävention stecken. Aber auch wir wollen mehr tun.
Wir würden Versicherte gern proaktiv auf Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen hinweisen. Wir könnten auch Diabetes- und Herz-Kreislauf-Patienten gezielt beraten. Aber das dürfen wir nicht, selbst wenn ihr Einverständnis vorliegt. Wir werden erst aktiv, wenn das Kind schon im Brunnen ist. Der Datenschutz ist derzeit ein Präventionshindernis.

Wie ließe sich Prävention verbessern?
Zunächst muss man sich über die Dimension klar werden: Ernährung, Bewegung, Wohnumfeld, Bildung, all das hat Einfluss auf unsere Gesundheit. Als Ökonomin denke ich über Preisanreize nach. Ich könnte mir zum Beispiel eine Steuer auf stark verarbeitete Lebensmittel vorstellen, die besonders ungesund sind.
Wie wäre es mit höheren Tabak- und Alkoholsteuern und einer Zuckersteuer?
Wir müssen uns in der Tat überlegen, ob wir es uns weiter leisten können, dass ungesunde Lebensmittel günstiger sind als gesunde. Ich bin keine Freundin von Verboten. Ähnlich wie beim Sicherheitsgurt im Auto ginge es dann eher um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Die Steuer könnte der Bund einführen, sie würde schnell greifen, wie wir im Ausland sehen. Wichtig ist mir aber vor allem, dass wir die Gesundheitskompetenz stärken, und das von klein auf. Außerdem ist ein Schulfach „Gesundheit“ einzuführen, für das die Länder zuständig sind. Der Präsident der Bundesärztekammer und ich haben uns bei den Länderministern den Mund fusselig geredet für die Gesundheitsbildung. Am Ende kam nur der Vorschlag für eine Plakataktion heraus. Das ist leider Föderalismus in Reinkultur.
Wie geht es den Kassen finanziell?
Die Lage im Gesundheitswesen ist dramatisch. Die GKV-Ausgaben wachsen mit acht Prozent, die Einnahmen nur mit gut fünf. Diese Schere kann kein System aushalten. Und wir wissen noch nicht, wie sich die schwächer wachsende Beschäftigung auf die Einnahmen auswirken wird. Klar ist: Die politischen Bemühungen fruchten bisher nicht. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2026 auf 2,9 Prozent festgelegt, tatsächlich brauchen die Kassen aber mehr als 3,1 Prozent. Wenn die Ministerin jetzt sinngemäß sagt, die Kassen seien selbst schuld, dass sie mit dem Geld nicht hinkommen, führt das in die Irre.
Warken hat ein Sparpaket für 2026 vorgelegt, die Länder haben es verwässert.
Das waren allenfalls Peanuts. Statt der vorgeblichen 1,8 Milliarden Euro wären ohnehin höchstens 1,3 Milliarden an Einsparungen drin gewesen. Und das bei weit mehr als 300 Milliarden Euro Gesamtausgaben der GKV. Warkens Sparideen reichen vorn und hinten nicht. Ich rechne damit, dass die Beitragssätze noch im laufenden Jahr weiter steigen, wenn die Bundesregierung jetzt nicht gegensteuert.
Wie bitte? Ich habe gerade erst Post mit einer Beitragserhöhung erhalten.
Ja, viel spricht dafür, dass Sie einen weiteren Brief bekommen und die Beitragssätze unterjährig steigen, wenn nicht schnell etwas auf der Ausgabenseite passiert.
Wie lassen sich höhere Beiträge abwenden?
Der Bund sollte endlich die versicherungsfremden Leistungen übernehmen, mindestens zehn Milliarden Euro jährlich allein für die Beiträge der Bürgergeldempfänger. In der Pflege geht es um einen ähnlichen Betrag für die Rentenbeiträge der pflegenden Angehörigen und die Corona-Kosten. Wenn das der Bund schultert, wie es seine Aufgabe ist und immer wieder versprochen hat, brauchen wir weder Darlehen noch Beitragserhöhungen. Erstmals in der Geschichte der GKV klagen wir gegen den Bund, damit er die versicherungsfremden Leistungen zahlt. Dieser ungewöhnliche Schritt zeigt, wie groß die Verzweiflung ist.
Die Länder kommen ihrer Pflicht nicht nach, die Investitionen der Kliniken und Pflegeheime zu tragen. Klagen Sie auch gegen die Länder?
Das müsste man eigentlich tun, aber das ist wegen der föderalen Struktur sehr schwierig. Wir konzentrieren uns jetzt erst einmal auf den Bund und sind zuversichtlich, die Klage zu gewinnen.
Welche Ausgaben laufen aus dem Ruder?
Sehr viele. Das Verrückte ist, dass eigentlich eine einnahmenorientierte Ausgabenpolitik gilt: Es darf nur das an Kosten entstehen, was auch finanzierbar ist. Der Gesetzgeber hat diese Begrenzung jedoch selbst ausgehebelt, etwa im Pflegebudget. Die Kliniken reichen ihre Pflegekosten einfach an die Kassen durch, die auf die Zahl der Kräfte oder deren Entlohnung keinerlei Einfluss haben. Das war ursprünglich gut gedacht, aber inzwischen sind die Pflegegehälter so hoch, dass man das unbegrenzte Pflegebudget abschaffen sollte. Zumal es Missbrauch gibt.
Kliniken setzen Pflegekräfte dazu ein, Flure zu wischen, anstatt am Krankenbett zu sein. Controller werden nur der Form halber zu Pflegeassistenten weitergebildet, damit man sie über das Pflegebudget abrechnen kann. Ich halte das für Betrug. Die Gewerkschaft Verdi will sogar, dass künftig alle Klinikmitarbeiter direkt von den Kassen bezahlt werden. Dann sitzen wir wieder nicht mit am Tisch, das wird völlig unkontrollierbar und ist nicht zu bezahlen.
Wie sieht es mit den ambulanten Kosten aus?
Uns macht die Entbudgetierung Sorgen, das Ende der Honorardeckel in den Praxen. Es hat mit den Kinderärzten angefangen. Aber statt mehr Patienten zu betreuen und mehr Termine anzubieten, rechnen sie mehr Behandlungen je Kind ab. Die Versorgung hat sich also nicht verbessert. Das befürchten wir auch von der Entbudgetierung der Hausärzte. Stationär wie ambulant haben wir eine auf Masse ausgelegte Vergütung, die jeden Fall belohnt, nicht die Qualität oder den Behandlungserfolg. Auch in der Pflege hat niemand Interesse daran, Pflegebedürftige gesund zu halten. Je höher ihr Pflegegrad, desto mehr Geld gibt es. Wer Menge bestellt, bekommt auch Menge.
Wo lässt sich noch sparen?
Bei Arzneimitteln. Es würde die Kassen um sechs bis sieben Milliarden Euro entlasten, wenn die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent fiele. Man fasst sich an den Kopf: Für Nutztiere gilt der ermäßigte Satz auf Medikamente, für Menschen aber nicht. Sparpotentiale gibt es auch bei „Orphan Drugs“ für seltene Leiden. Überdies könnte man den Herstellerabschlag erhöhen, ohne dass der Pharmaindustrie das Geld ausginge.
Was halten Sie von einer Praxisgebühr?
Nichts. Drei, vier Euro je Kontakt, die jetzt im Gespräch sind, erzeugen nur Aufwand und Frust. Die vielen Patientenkontakte in Deutschland liegen nicht daran, dass die Leute gern zum Arzt gehen, sondern daran, dass wir alle gesundheitlichen Fragen ärztlich und in der Praxis beantworten.

Warken will mehr Patientensteuerung.
Ja, die muss es geben, aber nicht durch eine Gebühr, sondern durch eine sinnvolle Primärversorgung. Die muss nicht ärztlich erfolgen, und auch nicht physisch in der Praxis. Wir brauchen eine verlässliche, digital erfasste Ersteinschätzung, die telemedizinisch und von Pflegekräften erbracht werden darf. Oft geht das fallabschließend mit Ibuprofen und Bettruhe. Falls mehr nötig ist, sollte der Primärversorger den Patienten in die richtigen Versorgungspfade lotsen und danach gut koordinieren. Das hieße auch, ihm Facharzttermine zu besorgen. Polen hat den Umschwung geschafft: Früher wurden 80 Prozent der Fälle ärztlich und 20 Prozent pflegerisch betreut, jetzt ist es umgekehrt.
Warum stockt die Klinikreform?
Das liegt an Ängsten und am Kirchturmdenken. Jedes Bundesland will Sonderregeln, jede Klinik will bleiben, wie sie ist. Bürger protestieren gegen die Schließung von Krankenhäusern, in die sie selbst nie gehen würden. In der Neufassung des Gesetzes stehen so viele Ausnahmen, dass sich die Versorgungsqualität vermutlich nicht grundsätzlich verbessern wird. Das ist brandgefährlich. Wir brauchen mehr Politiker mit Mut, und wir brauchen ein neues Narrativ.
Dass die Klinikreform den Menschen nicht etwas wegnimmt, sondern ihnen etwas gibt: dass sie Leben rettet. Es gibt Stationen zur Versorgung von Frühgeborenen, die haben kaum Erfahrung. Die spielen mit dem Leben der Kinder und mit der Verzweiflung der Eltern. In Dänemark hat die Reform funktioniert. Die Menschen dort merken, dass sie besser versorgt werden, obwohl viele Häuser geschlossen wurden. Für Deutschland ist der Status quo keine Option. Für das, was das Gesundheitssystem leistet, ist es viel zu teuer: Die gesetzlichen Krankenkassen geben jede Stunde 40 Millionen Euro für die Gesundheitsversorgung ihrer Versicherten aus. Uns fehlt nicht das Geld, uns fehlt der Mumm zu Veränderungen.
Die Krankenkassen sind auch die Pflegekassen. Wie ist dort die Lage?
Ebenfalls höchst angespannt. Weitere Beitragssatzsteigerungen können 2026 nur durch neue Bundesdarlehen vermieden werden. Aber dieser Weg verschiebt das Problem nur, die vier Darlehen müssen irgendwann zurückfließen. Ich erwarte, dass im Sommer oder Herbst abermals Pflegekassen in Liquiditätskrisen geraten und gerettet werden müssen. Auch in der Pflege geben wir viel zu viel aus.
Für Heimbewohner übernehmen die Kassen sogenannten Leistungszuschläge von bis zu 75 Prozent der pflegerischen Eigenanteile. Das kostet Milliarden und wird unabhängig vom Einkommen und Vermögen gezahlt, auch für sehr Wohlhabende. Das ist sozialpolitisch fragwürdig. Wir müssen kritisch prüfen: Wo wird das Solidarsystem zum Erbenschutzprogramm.
Wie gut läuft der Pflegegrad 1?
Er ist dafür gedacht, dass die Pflegebedürftigen nicht in höhere und teurere Grade abrutschen. Aber das funktioniert nicht, weil der sogenannte Entlastungsbetrag häufig für haushaltsnahe Dienste verwendet wird, für Fensterputzer statt für Mobilitätsförderung. Sinnvoll wäre es, diese Mittel konsequent für Prävention zu nutzen: Bewegung, Ernährung, Sozialkontakte, kognitive Übungen. Das könnte über Gutscheine laufen.
Was erhoffen Sie sich von Warkens Kommissionen zu Pflege und Gesundheit?
Wenn sie gute Vorschläge machen, können wir das Ruder noch herumreißen. Meine Hoffnung ist, dass der alte Werbespruch von Verona Feldbusch für die Telefonauskunft auch für Gesundheit und Pflege aufgeht: „Hier werden Sie geholfen.“ Der Druck im Kessel ist enorm, vielleicht so hoch wie nie. Wenn man daraus etwas Positives ziehen will, dann dass Veränderungen jetzt unvermeidlich sind. 2026 ist ein Kipppunkt. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es nichts mehr mit den Reformen in dieser Legislaturperiode. Die Sache ist auch politisch brisant.
Die politischen Ränder besetzen das Thema immer mehr. Die AfD hat die Defizite in der Versorgung entdeckt, die Misere lässt sich im Wahljahr 2026 populistisch ausschlachten. Die demokratischen Kräfte müssen die Gesundheits- und Pflegepolitik daher dringend ganz oben auf ihre Agenda setzen.
Schnellbootkapitänin der Krankenkassen
Anne-Kathrin Klemm sitzt in dem Büro einer anderen einflussreichen Frau. In dem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert am Bethlehemkirchplatz in Berlin-Mitte saß Ende der Neunzigerjahre die Bundesgeschäftsstelle der CDU. In Klemms Arbeitszimmer tat Generalsekretärin Angela Merkel Dienst, in der Etage darüber wohnte sie. Klemm ist seit Juli 2025 Alleinvorstand des BKK-Dachverbands, der die Interessen von 64 Betriebskrankenkassen (BKK) und vier Landesverbänden vertritt.
Betriebskrankenkassen gibt es seit mehr als 100 Jahren. Einst standen sie nur den Mitarbeiterfamilien des namensgebenden Trägerunternehmen offen, darunter Dax-Konzerne und viele Mittelständler. Erst Mitte der Neunzigerjahre öffneten sich die meisten BKK für betriebsferne Mitglieder bundesweit oder regional. Ihre oft kleinen, wendigen Kassen nennt Klemm „Schnellboote“.
Klemm wurde 1966 im nordhessischen Frankenberg/Eder geboren. Nach der Bankausbildung arbeitete sie in einer Sparkasse und einer Papierfabrik, studierte dann Volkswirtschaft in Dortmund, Freiburg und Ontario. Stationen in der Kassenärztlichen Vereinigung Südbaden, im AOK-Bundesverband und bei Deutschlands größter Krankenkasse, der Techniker, folgten. 2014 wechselte sie zum BKK-Dachverband und war erst Vertreterin, dann gleichberechtigte Kollegin des Vorstands Frank Knieps, eines Urgesteins der Gesundheitspolitik. Sie ist verheiratet und kann wunderbar malen.